Diese Bildmontage zeigt den Blick auf die untere Hemisphäre der Targetkammer (blau) der National Ignition Facility mit den Strahlführungen der Hochleistungslaser im Vordergrund (Bild: Damien Jemison / NIF, vgl. S. 29)


Diese Bildmontage zeigt den Blick auf die untere Hemisphäre der Targetkammer (blau) der National Ignition Facility mit den Strahlführungen der Hochleistungslaser im Vordergrund (Bild: Damien Jemison / NIF, vgl. S. 29)
Interview mit Eberhard Bodenschatz
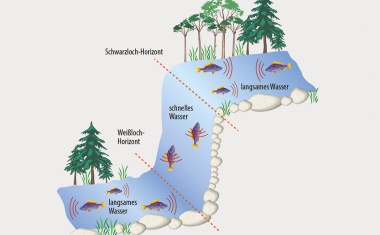 • 4/2019 • Seite 20
• 4/2019 • Seite 20Mithilfe eines optischen Analogsystems ist es nun gelungen, Hawking-Strahlung mit externem Licht zu stimulieren.
 • 4/2019 • Seite 24
• 4/2019 • Seite 24Nach der Promotion wechselte Dr. Volkmar Denner zur Robert Bosch GmbH. Heute ist er dort Vorsitzender der Geschäftsführung.
Bei der Robert Bosch GmbH hat Dr. Volkmar Denner (62) eine Bilderbuchkarriere hingelegt: Vom Fachreferent stieg der Physiker bis zum Vorsitzenden der Geschäftsführung auf.
Wie kamen Sie damals zu Bosch?
Nach meiner Promotion wäre ich gerne Professor für theoretische Physik geworden. Aber zu der Zeit gab es an der Universität nur befristete Stellen. Da ich eine Familie gründen wollte, schien mir das keine solide Basis zu sein. Bosch bot mir die Möglichkeit, in der Halbleitertechnologie an vorderster Front der Technik zu arbeiten, und so habe ich den Wechsel in die Industrie gewagt.
Das war ein ziemlicher Sprung von der theoretischen Physik in die Halbleiterentwicklung…
Ich hatte im Studium Halbleitertechnik als Wahlfach und somit Berührung zu dem Thema. Meine ersten Arbeiten bei Bosch waren zudem Simulationen von Halbleiterprozessen. Das war ähnlich zu dem, was ich an der Universität gemacht hatte.
Was waren Ihre wichtigsten beruflichen Stationen?
Ich habe als Fachreferent in der Mikroelektronik begonnen. Anschließend habe ich den Geschäftsbereich gewechselt und mich mit Motorsteuerungen für Benzinmotoren beschäftigt. Später habe ich den Bereich Automotive Electronics geleitet, bis ich 2006 in die Geschäftsführung berufen wurde. Seit 2012 bin ich deren Vorsitzender. Ich habe bei Bosch sämtliche Führungsstufen durchlaufen – mit der Mikroelektronik als rotem Faden. (...)
 • 4/2019 • Seite 29
• 4/2019 • Seite 29An der National Ignition Facility lassen sich Plasmen erzeugen, welche die Bedingungen im Inneren von Sternen reproduzieren – aber nur für Sekundenbruchteile.
Durch Fusionsreaktionen in Sternen entstehen neue Elemente. Um die Mechanismen dahinter zu verstehen, müssen die Reaktionsraten genau bekannt sein. Allerdings erweist es sich als äußerst aufwändig, die Bedingungen eines stellaren Plasmas im Labor zu reproduzieren. Darüber hinaus stellt die Analyse der messbaren Daten eine enorme Herausforderung dar.
Als Energiequelle von Sternen spielen kernphysikalische Reaktionen und Zerfälle instabiler Isotope eine wichtige Rolle. Sie sind der Motor der Sternentwicklung. Kernreaktionen setzten die Energie frei, um den Stern gegen die Gravitationskräfte zu stabilisieren, die aus seiner gewaltigen Masse resultieren und sonst seinen Kollaps zur Folge hätten. Je schwerer ein Stern ist, desto mehr Energie muss er produzieren: In seinem Inneren herrschen höhere Temperaturen, bei denen die Fusionsprozesse schneller ablaufen können. Deswegen haben schwere Sterne eine kürzere Lebensdauer als leichtere. Die Sternentwicklung läuft in mehreren Phasen ab, die durch unterschiedliche Fusionsbrennstoffe geprägt sind. Während der ersten Phase des Wasserstoffbrennens wandelt sich Wasserstoff über verschiedene Reaktionssequenzen zu Helium um – in dieser Phase befindet sich unsere Sonne gerade.
Ist der Wasserstoff verbraucht, kontrahiert der Stern, Temperatur und Dichte im Inneren steigen an, bis Fusions- und Kernreaktionen mit Helium möglich sind. Die dann freigesetzte Energie stabilisiert den Stern erneut. Allerdings bläht sich dabei die Sternhülle auf, sodass ein Roter Riese entsteht. Ein bekanntes Beispiel ist Betelgeuse (α Orionis). Auf das Heliumbrennen folgt das Kohlenstoffbrennen und um den stellaren Kern bilden sich Hüllen, in denen das dort vorhandene Helium und weiter außen der Wasserstoff fusionieren. Diese Entwicklung setzt sich fort bis zum Aufbau von Eisen im Sterninneren. Hier ist die Bindungsenergie der Kerne am größten, sodass weitere Kernreaktionen Energie benötigen anstatt diese freizusetzen. Deshalb wird der Stern instabil und bricht in sich zusammen, woraus sich eine Supernova entwickelt. (...)
 • 4/2019 • Seite 35
• 4/2019 • Seite 35Weltweit zielen verschiedene Experimente darauf ab, den neutrinolosen doppelten Betazerfall nachzuweisen.
Falls sich Neutrino und Antineutrino unterscheiden, wären sie Dirac-Teilchen. Sind sie jedoch identisch, weisen sie Eigenschaften eines Majorana-Teilchens auf. Der Majorana-Charakter bietet die Möglichkeit, die ungewöhnlich kleine Masse der Neutrinos theoretisch zu verstehen und die Entstehung der Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie im frühen Universum zu erklären. Viele Teilchenphysiker glauben daher, dass das Neutrino Majorana-Charakter haben muss. Doch der Nachweis fehlt. Diesen sollen verschiedene Experimente erbringen, indem sie den extrem seltenen neutrinolosen doppelten Betazerfall beobachten.
Der doppelte Betazerfall eines Atomkerns bedeutet die gleichzeitige Umwandlung von zwei Neutronen zu Protonen durch die schwache Wechselwirkung. 1935 berechnete Maria Goeppert-Mayer diese Zerfallsart zum ersten Mal [1]. Normalerweise gehen Atomkerne mit einem Überschuss an Neutronen durch einfache Betazerfälle sukzessive in stabilere Kerne über. Kerne mit gerader Neutronen- und gerader Protonenzahl wechseln dabei stets zwischen gerade-gerade und ungerade-ungerade Kernen. Aufgrund der Paarwechselwirkung zwischen Nukleonen kann der einfache Betazerfall aber energetisch verboten sein, während der doppelte Betazerfall zu einem stabileren Kern führt (Abb. 1). Prominente Beispiele sind die Isotope 76Ge, 130Te und 136Xe.
Normalerweise findet der doppelte Betazerfall unter Aussendung von zwei Elektronen und zwei Anti-Elektronneutrinos statt, also einem Paar von Leptonen und einem Paar von Antileptonen (2νββ-Zerfall). Die Leptonenzahl (für Leptonen + 1, für Antileptonen –1) bleibt dabei erhalten (ΔL = 0) und die Symmetrie zwischen Materie und Antimaterie gewahrt. Da zwei Prozesse der schwachen Wechselwirkung gleichzeitig stattfinden, ist der Zerfall extrem selten. Dennoch ist er mittlerweile in einer Reihe von Isotopen nachgewiesen. Die Lebensdauern bewegen sich zwischen 1018 und 1021 Jahren. Bei dem Zerfall ergibt sich für die Elektronen ein kontinuierliches Spektrum der Summenenergie (Abb. 2), das sich von Null bis zum Q-Wert Qββ des Zerfalls erstreckt, der im Wesentlichen der Massendifferenz von Anfangs- und Endkern entspricht. Die kinetische Energie der Antineutrinos ist nicht nachweisbar. (...)
 • 4/2019 • Seite 42
• 4/2019 • Seite 42Der Umgang mit Messdaten im Praktikum erfordert auch eine Messunsicherheitsanalyse.
Die Messunsicherheitsanalyse ist ein zu Unrecht unbeliebter Teil der Physikausbildung, den die Studierenden meist nicht ausreichend beherrschen. Der international anerkannte „Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen“ sowie moderne Lehrformate bieten jedoch einen guten Zugang zu diesem Thema.
Müssen wir wirklich noch eine Fehlerrechnung machen? Dies fragen die Studierenden in nahezu jedem physikalischen Praktikum. Die Fehlerrechnung oder nach aktueller Sprechweise die Messunsicherheitsanalyse ist nicht nur sprachlich sperrig, sondern auch unbeliebt. Die Messung gilt als interessant und verspricht neue Erkenntnisse. Die Messunsicherheitsanalyse hingegen scheint langweilig, wenig spektakulär und letztendlich überflüssig. Die entscheidende Information, um die es ging, ist scheinbar bereits durch die Auswertung der Daten herausgekommen. Die angehängte Betrachtung der Genauigkeit des Ergebnisses empfinden die Studierenden eher als Entwertung der eigenen Arbeit.
Dass bei der Berechnung eines Ergebnisses auch Überlegungen zu dessen Unsicherheit dazugehören, ist sicher allen Studierenden klar. Den zentralen Informationsgehalt und Nutzen dieser Angabe sehen aber nur wenige. So lassen sich Ergebnisse erst quantitativ vergleichen, wenn die Unsicherheit berücksichtigt wird. Denn ob zwei Ergebnisse gleich oder verschieden sind – oder wie wahrscheinlich es ist, dass zwei Ergebnisse übereinstimmen –, ist aus den Zahlenwerten allein nicht abzulesen. Aber gerade der Vergleich mit bekannten Ergebnissen oder den Vorhersagen von Modellen macht die Arbeit in der Physik aus. Hier entstehen neue Erkenntnisse. (...)
Bei der Auftaktveranstaltung des DPG-Mentoring-Programms kommen sich Mentoren und Mentees näher.